|
|
|
Von Wien nach
Shanghai:
Der Architekt Leopold Ponzen
Iris MEDER
Leopold Ponzen wurde am 12. 12.
1892 in Wien geboren. Seine Eltern Ludwig Ponzen, Kaufmann aus dem südmährischen
Nikolsburg (Mikulov), und Berta Brandl hatten im Jahr 1886 geheiratet. Nach der
Matura studierte Leopold Ponzen, ab 1914 durch den Kriegsdienst unterbrochen,
Architektur.
Wie fast alle jüdischen Architekturstudenten besuchte er die von
Carl König geleitete Technische Hochschule; die Meisterklasse Otto Wagners an
der Kunstakademie wurde wegen des dort herrschenden antisemitischen Klimas von
jüdischen Studenten gemieden. An der TH freundete sich Ponzen unter anderem mit
dem gleichaltrigen Felix Augenfeld an. 1
Unter den einige Jahre älteren TH-Absolventen Oskar Strnad, Josef Frank und
Oskar Wlach hatte sich in den Jahren von Ponzens und Augenfelds Studium eine
Adolf Loos nahestehende neue Architekturauffassung vor allem im Wohnbau
entwickelt, die sich von der Wagner-Schule und der Wiener Werkstätte mit ihrem „Garniturdenken"
nachdrücklich absetzte. Mit ihren Mitstreitern und den meisten Nachfolgern
gemeinsam war Frank, Strnad und Wlach die Herkunft aus dem assimilierten
jüdischen Bürgertum. Ihre Eltern waren wie die Ponzens aus den Kronländern nach
Wien zugewandert.
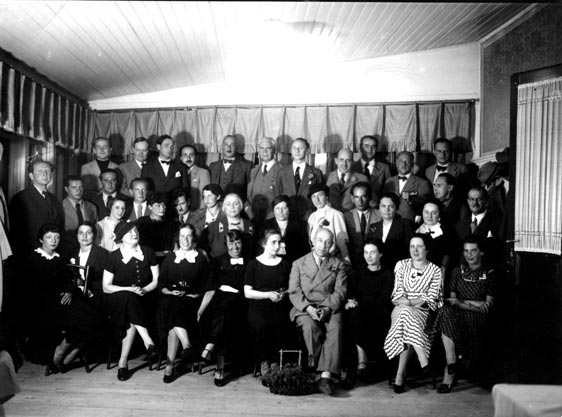
Feier zu Josef Franks 50. Geburtstag in Wien-Speising hintere
Reihe: Leopold Ponzen 5. v. l. mit Fliege und Schnurrbart, 4. v. r. Felix
Augenfeld, ganz rechts Karl Hofmann; Josef Frank in der vorderen Reihe sitzend
(Bezirksmuseum Wieden, Wien)
Bereits 1913 veröffentlichte die
„Wiener Bauindustrie-Zeitung" einige Reiseskizzen Ponzens. Nachdem er die zweite
Staatsprüfung 1918 mit Auszeichnung bestanden hatte, wurde Ponzen 1919 Mitglied
des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, 1921 außerordentliches
Mitglied der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs und war außerdem
Mitglied des Österreichischen Werkbunds. 1925 arbeitete er als Projektleiter im
Büro von Oskar Strnad, der mit seinem Projekt „Wasser und Sonne" ex aequo mit
Clemens Holzmeister den geladenen Wettbewerb zu einem großzügigen Kurzentrum im
oberösterreichischen Bad Schallerbach gewonnen hatte. 2
Mit der Ausführungsplanung wurden Strnad und Holzmeister gemeinsam beauftragt.
Zusammen arbeiteten sie ein neues Projekt mit dem Motto „Rund" aus. Holzmeisters
Projektleiter war der ebenfalls an der TH ausgebildete Max Fellerer, der sich in
einem Brief an seinen Freund Milan Dubrovic an seine Tage als Student und junger
Architekt erinnert:
„Dieses Studium, bei dem mir ein einziger Lehrer, der
Jude König, imponierte, war meine selbstbewußteste Zeit. [1925] tauchte
Holzmeister in Wien auf und wollte mich für Wien als Kompagnon haben. Ich
lehnte ab, nach Anhörung seines ersten in Wien gehaltenen Vortrages, denn
was er brachte war schauerlich. So rächt sich der schwächliche
Sauberkeitssinn, die mimosenhafte Skrupelhaftigkeit. Ich ging für 1 ½ Jahre
als sein Vertreter in das Wiener Baubüro der Schwefelbad Schallerbach AG, wo
ich mit dem Vertreter Strnad‘s, dem Architekten Leopold Ponzen, innigste
Freundschaft schloß." 3
Der Entwurf von Holzmeister und
Strnad wurde wegen zu hoher Kosten letztlich nicht ausgeführt, das Kurbad erst
1931-37 nach Entwürfen des Wagner-Schülers Mauriz Balzarek gebaut. Ponzen machte
sich selbständig und konnte als Sieger eines 1926 ausgeschriebenen Wettbewerbs
1928 das jüdische Kriegerdenkmal am Wiener Zentralfriedhof (Tor I, Gruppe 76B)
realisieren, einen eleganten Oktogonalbau in hellem Konglomeratstein mit einem
Kranz aus gesetzestafel-artigen Zinnen. 4
Ponzens Büro in der Müllnergasse 5
im 9. Bezirk5
war jedoch alles andere als ausgelastet. Weitere Aufträge blieben aus. Anders
als andere außerhalb der Gemeindebautätigkeit wenig beschäftigte Wiener
Architekten befasste sich Ponzen nicht mit Möbelentwürfen und
Wohnungseinrichtungen. An der Architektur interessierte ihn mehr das
Konstruktive.
Das Jahr 1932 begann für Ponzen
mit dem Wettbewerb „Das wachsende Haus" hoffnungsvoll. Auslober des Wettbewerbs
zu dem international hochaktuellen Thema waren das Österreichische Kuratorium
für Wirtschaftlichkeit (ÖKW), die Handelskammer, die Wiener Messe und die
„Arbeitsgemeinschaft von Handel, Gewerbe und Industrie zur Förderung der
privaten Wohnbautätigkeit". Wie Max Eisler in seiner Besprechung des Wettbewerbs
in der deutschen Architekturzeitschrift „Moderne Bauformen" betonte, lag daher –
und auch in der Besetzung der Jury hauptsächlich mit Wirtschaftsfachleuten – der
Hauptakzent mehr auf ökonomischen als auf architektonischen Aspekten. Der Kern
der zu entwerfenden Häuser mit vorgefertigten Elementen sollte nicht unter 30,
die Endausbaustufe nicht über 80 m² groß sein, das Haus aber in jeder
Ausbaustufe ein vollwertiges Wohnhaus darstellen. Die Kosten für das Kernhaus
sollten ohne Fundamentierung und Unterkellerung 5000 Schilling nicht
übersteigen. Der Wettbewerb bot nicht zuletzt den Anreiz, mit kostensparenden
rationellen Konstruktionsweisen zu experimentieren, was in Wien, das für die
städtischen Wohnbauten traditionelles Massiv-Ziegelmauerwerk vorschrieb, selten
möglich war.
Unter den 147 eingegangenen Entwürfen österreichischer
Architekten wurde ein erster Preis von der Jury, in der auch Ponzens Freund Max
Fellerer saß, nicht vergeben. Eine Auswahl der Häuser wurde im Frühjahr 1932 im
Rahmen der Baumesse auf dem Wiener Messegelände in 1:1-Modellen der Kernhäuser
temporär realisiert, darunter auch Ponzens preisgekrönter und viel publizierter
Entwurf einer Zweigelenkrahmen-Konstruktion, bei der die vorgefertigten
Eisenbetonrahmen auf dem Bauplatz armiert wurden. 6
Der erdgeschossige Kernbau mit zentralem Vordereingang sollte in der ersten
Ausbaustufe an der Front erweitert und gleichzeitig teilweise aufgestockt
werden, so dass Schlafräume und Bad in das Obergeschoss verlegt werden konnten.
In der zweiten Ausbaustufe wurde der Rest des Erdgeschosses überbaut und dem
Obergeschoss gartenseitig ein Balkon vorgelegt, mit einem zweiten Wohnraum im
Obergeschoss. Die Konstruktion aus parallelen U-förmigen Rahmen mit einer
lichten Spannweite von 6,20 m in einem Abstand von 1 m lässt an Lösungen des in
den zwanziger Jahren nach Kalifornien ausgewanderten Loos-Schülers Rudolf M.
Schindler wie das Lovell Beach House denken.
Obwohl die Hausentwürfe patentrechtlich geschützt waren und
Modelle für die Serienproduktion sein sollten, ist nur eine einzige dauerhafte
Ausführung (des Entwurfs von Franz Klimscha und Gustav Pawek) bekannt. Ponzens
Haus, das der Formensprache der klassischen Wiener Moderne folgte, wurde im
selben Jahr auch in das von Hans Adolf Vetter und Josef Frank zusammengestellte
Buch „Kleine Einfamilienhäuser" aufgenommen, ebenso wie sein Entwurf eines
würfelförmigen „Hauses für einen Blumenfreund", das sich deutlich an der „Wiener
Schule" Josef Franks orientiert. Der Grundriss des Erdgeschosses ähnelt dem
Kernhaus des „wachsenden Hauses"; die Südseite des Wohnraums ist in ein großes
Blumenfenster aufgelöst.
Im Sommer 1932 wurde auch die Wiener Werkbundsiedlung
eröffnet, in der angeblich Ponzen Führungen leitete. 7
Im folgenden Jahr veröffentlichte er in der von der ZV herausgegebenen
Fachzeitschrift „profil" den Entwurf für „Haus und Garten eines Herrn"8,
einen querrechteckigen erdgeschossigen Walmdachbau mit zentralem Eingang. Der
gartenseitig querliegende Wohnraum, der sich mit vier Fenstertüren zum Garten
öffnet, nimmt fast die ganze Grundfläche des Junggesellen-Hauses ein. Zum Garten
schwingt es konkav ein, die seitlichen Wände sind, dem Schwung der Wand und des
vorgelagerten Wasserbeckens folgend, leicht abgewinkelt. Ein Vorbild war wohl
Clemens Holzmeisters Haus Eichmann, an dem auch Fellerer als Holzmeisters
damaliger Büroleiter beteiligt war. Realisieren konnte Ponzen in dieser Zeit nur
die nicht erhaltene Portalgestaltung des Wein- und Bierlokals Johann Kührer in
Wien 9, Hahngasse 24-26, unweit seines Büros.9
Nicht nur wegen des "wachsenden
Hauses" war das Jahr 1932 für Ponzen zunächst vielversprechend. Die Stadt Wien
hatte die aufsehenerregende Entscheidung getroffen, "die Kahlenbergfrage" zu
lösen. Das alte Kahlenberg-Hotel war das letzte Überbleibsel eines
Erschließungskonzepts aus der Zeit der Wiener Weltausstellung von 1873. Ein
Trakt des teilweise verfallenen Baus wurde als Hotel weitergeführt – unter
primitivsten Umständen, da der Kahlenberg weder an das Stromnetz noch an die
Wasserversorgung angeschlossen war. Abriss und Neubau schienen unvermeidlich.
Eine "moderne Akropolis für Wien" 10
sah der Architekturpublizist Max Ermers daher bereits entstehen, als schließlich
die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien befindliche Kahlenberg AG einen
Wettbewerb unter Wiener Architekten ausschrieb.
Ponzen arbeitete Anfang 1933 in seinem Büro in Wien 9,
Seegasse 16
zunächst allein am Kahlenberg-Projekt,
zog dann aber den mit einer besseren Büro-Infrastruktur ausgestatteten, aber
ebenso wenig ausgelasteten früheren Strnad-Assistenten Erich Boltenstern hinzu,
den er spätestens beim "wachsenden Haus", wo beider Projekte prämiert wurden,
kennen gelernt haben dürfte. Ihr kompromisslos modernes Kahlenberg-Projekt, an
dem Ponzen den überwiegenden Anteil hatte, verzichtete auf jede Monumentalität
und schmiegte sich mit seinem flachen Baukörper und der von den bestehenden
Mauern des Altbaus vorgegebenen abgeknickten Grundriss an den Hangverlauf. Die
Talseite des Restauranttrakts prägte eine lange Reihe großer Schiebefenster. Von
der schlichten Seitenwand der denkmalgeschützten Josefskirche war dank des
flachen Walmdachs mehr zu sehen als zuvor. Die 148 eingereichten Entwürfe wurden
im Messepalast ausgestellt. Der Jury gehörten u. a. Clemens Holzmeister, Oskar
Strnad und Max Fellerer an. Von 15 prämierten Projekten wurden sechs mit einer
detaillierteren Ausarbeitung beauftragt. Zwei erste Preise gingen schließlich ex
aequo an die Teams Carl Witzmann/Otto Niedermoser und Ponzen/Boltenstern.11
Die Realisierung des Projektes,
das neben einem Restaurant für Tausende Besucher unter anderem ein Wettkampfbad,
Tennisplätze, eine Skisprungschanze und ein Freilichttheater vorsah, musste
jedoch aus Geldmangel auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "148 Entwürfe und
eine tote Idee", titelte Paul A. Rares im "Wiener Tag" vom 18. Juli 1933 nicht
zu Unrecht. Im Oktober 1934 initiierte schließlich der neue Wiener Bürgermeister
Richard Schmitz eine Durchführung des Projekts in stark reduzierter Form. Die
politischen Verhältnisse hatten sich nach der Auflösung des Wiener Gemeinderates
im Anschluss an die Februarkämpfe bereits spürbar verschärft, der klerikale und
zunehmend offen antisemitische Ständestaat war endgültig auch auf kommunaler
Ebene installiert. Als Boltenstern allein mit der Ausführungsplanung betraut
werden sollte, waren es beiden klar, dass Ponzen aus dem Projekt gedrängt werden
sollte, weil er Jude war. Nachdem Boltenstern vergebens versucht hatte, eine
Mitwirkung Ponzens bei der Kahlenberg AG durchzusetzen, beschlossen beide, um
das Projekt nicht zu Fall zu bringen, dass Ponzen bei anteiliger Bezahlung
inoffiziell gleichberechtigt mitarbeiten sollte.
Für die Ausführung stand nur mehr
ein Ausflugsrestaurant zur Debatte, das, in Zeiten verheerender Arbeitslosigkeit,
Platz für 4.500 Gäste, darunter auch Picknickplätze für selbstversorgende
Wanderer, und eine große Aussichtsterrasse ohne Konsumationszwang bieten sollte.
Ponzen und Boltenstern arbeiteten gemeinsam ein weiteres Vorprojekt aus. Die
elegante Fensterband-Fassade wurde jedoch vom Stadtrat als "zu nüchtern"
klassifiziert und eine weitere Überarbeitung gefordert. Bei der Kahlenberg AG
galt Ponzens Mitarbeit trotz Boltensterns Wunsch, weiter mit ihm
zusammenzuarbeiten, als unerwünscht. Ponzen bestand schließlich lediglich auf
namentlicher Nennung auch seiner Person bei künftigen Publikationen des Projekts
in Fachzeitschriften. Während sich Boltenstern mit Ponzen solidarisch zeigte,
verweigerte die Kahlenberg AG auch hierzu ihre Zustimmung. Ponzen, der sich als
jüdischer Architekt zutiefst gekränkt sah, zog daraufhin für seine Person das
Projekt zurück und forderte dazu auch Boltenstern auf:
"Ich bitte Sie, Herr Kollege, diesen schweren Schritt zu
verstehen. Ich habe mich als Mensch und schaffender Architekt gedemütigt,
ich habe einen gewaltigen Prestigeverlust auf mich genommen, der in der
einseitigen Betrauung an Sie für mich liegt und glaube ein Äquivalent für
die ideellen Schäden dadurch zu finden, wenn ich mir die Möglichkeit offen
lasse, späterhin durch Hinweis auf Veröffentlichungen bei
Existenzschwierigkeiten auf diese Arbeit hinweisen zu können. Ich wünsche
Ihnen – und es wird Ihnen sicherlich gelingen – ein neues Projekt zu
verfassen und dieses zur Zufriedenheit Ihrer Auftraggeber durchzuführen." 12
Boltenstern folgte Ponzens Wunsch,
zog das Projekt zurück und bot der Kahlenberg AG an, kostenfrei eine Neuplanung
zu erarbeiten.
Die Kahlenberg AG schrieb
daraufhin Anfang 1935 einen neuerlichen engeren Wettbewerb aus, diesmal zwischen
Boltenstern und dem 1933 zweitgereihten Oswald Haerdtl. Gemäß den Wünschen des
Stadtrates hatte Boltensterns neues Projekt keine durchgehende Fensterfront mehr,
Schiebefenster und Vollverglasung wechselten mit Fenstertüren ab. Ponzen hatte
sich aus dem Projekt völlig zurückgezogen. Das Kahlenberg-Restaurant wurde
wenige Wochen nach dem Prestigeprojekt Höhenstraße am 22. Dezember 1935 eröffnet.
Mit seiner von Strnad hergeleiteten zeitgemäß schlichten Formensprache verstand
es Boltenstern, abstrahierte Barock-Anklänge herzustellen, die dem konservativen
Wiener Publikum die Sicherheit einer verständlichen Semantik bei gleichzeitiger
Modernität gaben.

Kriegerdenkmal, Wien, Zentralfriedhof, 1926-28 (Foto Iris
Meder)
Das Verhältnis zwischen
Boltenstern und Ponzen kühlte durch die Affäre stark ab. Trotz der vermittelnden
Bemühungen des mit beiden befreundeten Max Fellerer lehnte Ponzen im Gegensatz
zu Boltenstern jede Aussöhnung ab. Boltensterns 1926 geborener ältester Sohn
Erich erinnert sich seinerseits nicht, dass sein Vater Ponzen jemals erwähnt
hätte. Über die ZV und die Ingenieurkammer hatte Ponzen Verfahren angestrengt,
die klären sollten, ob die Zurücksetzung aufgrund seiner Religionszugehörigkeit
zulässig sei. Nach einer Besprechung mit drei Mitgliedern des Ehrenrates der ZV
(unter denen mit Fritz Reichl auch ein Architekt jüdischer Herkunft war) wurde
ihm schließlich durch den ZV-Präsidenten Clemens Holzmeister mitgeteilt, seine
Benachteiligung sei auf jeden Fall unzulässig, die Angelegenheit aber eher Sache
der Kultusgemeinde als der Architektenverbände. Boltenstern treffe jedenfalls
keine Schuld an seiner Zurücksetzung. Auch der Ehrenrat der Ingenieurkammer wies
Ponzens Beschwerde zurück. 13
1934 projektierte Ponzen für die
jüdische Familie Boros/Weiner den Umbau eines alten Hauses am Hauptplatz (Hlavná
ulica 11) im ostslowakischen Kaschau (Košice). Das Projekt wurde mit einem
erläuternden Text Ponzens in "profil" 14
veröffentlicht. Das Erdgeschoss mit Graveurwerkstatt blieb erhalten, das
Obergeschoss wurde als Wohnung des Hausbesitzers, seiner Frau, seiner Mutter und
der beiden erwachsenen Söhne komplett umgebaut. Dabei entstand ein atriumartiger
exedraförmiger Dachgarten, um den sich an einem wintergartenartigen Flur die
Räume gruppierten. Die Dachterrasse und die Fassade mit französischen Fenstern
im ersten und für die Wiener Schule typischen Rundfenstern im zweiten
Obergeschoss sind an dem heute veränderten Haus noch erhalten.15
1935 nahm Ponzen am Fest zu Josef
Franks 50. Geburtstag teil, den Frank in Wien feierte, obwohl er mit seiner Frau
bereits Ende 1933 nach Stockholm emigriert war. Ponzen war zu dieser Zeit als
Baugutachter bei der Gebäudeverwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde tätig. 16
Architektonische Planungen aus der Zeit nach dem Dachgarten-Projekt sind nicht
bekannt. Nach dem "Anschluss" 1938 emigrierte Ponzen über Japan nach Shanghai,
wo rund 18 000 Menschen Zuflucht vor dem nationalsozialistischen Regime fanden.
Mit Viktor Lurje floh mindestens ein weiterer Wiener Architekt nach Shanghai.
1883 in Wien geboren, hatte Lurje wie Ponzen bei Carl König an der Technischen
Hochschule studiert. Er arbeitete jedoch kaum als Architekt und entwarf,
teilweise in Zusammenarbeit mit Frank und Strnad, Ausstellungsgestaltungen,
Gebrauchsgegenstände und Möbel, die er oft mit Intarsien nach eigenen Entwürfen
versah.17
Vom Anfang der vierziger Jahre stammen Reiseskizzen Lurjes aus Indien18;
er starb wenig später. Ob Kontakte zu Ponzen bestanden, ist nicht bekannt.
Strnad war bereits 1935 gestorben,
Felix Augenfeld floh nach New York. Max Fellerer kündigte seinen Posten als
Rektor der Kunstgewerbeschule und blieb im "inneren Exil" in Österreich. Er
beteiligte sich am passiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus und
versteckte jüdische Freunde in seiner Wohnung im Hochhaus in der Herrengasse.
Der als politisch unzuverlässig und "rot" geltende Boltenstern verlor alle
Lehraufträge und hielt seine sechsköpfige Familie mit privaten Bauaufträgen über
Wasser.
Über die Lebensumstände und
architektonischen Planungen Ponzens in seiner Zeit in Shanghai ist nichts
bekannt. Angeblich arbeitete er dort als Theaterarchitekt. 19
Das einzige dauerhaft nach seinen Entwürfen realisierte Projekt dürfte,
abgesehen vom verändert ausgeführten und im Jahr seines 70jährigen Bestehens
großteils demolierten Kahlenberg-Restaurant, das jüdische Kriegerdenkmal am
Zentralfriedhof sein, das letztlich Ponzens einziges erhaltenes und
glücklicherweise auch gut instand gehaltenes Werk darstellt. Es ergibt sich das
heterogene, bruchstückhafte Bild eines Architekten, der in seiner Tätigkeit
immer wieder gehemmt und behindert wurde und kaum Möglichkeiten hatte, seine
Projekte ausgeführt zu sehen. Trotz seiner entmutigenden Erfahrungen plante
Ponzen bald nach Kriegsende, nach Wien zurückzukehren. Dazu kam es nicht mehr.
Ponzen starb am 10. 10. 1946 in Shanghai an Leukämie.20
-
1 s. Briefwechsel im Teilnachlass Augenfelds im Jüdischen
Museum Wien. Augenfeld, der neben seinem TH-Studium auch die Bauschule von Adolf
Loos besuchte, gründete nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft mit
Oskar Strnads Assistenten Karl Hofmann das Büro Hofmann/Augenfeld, das
zahlreiche Aufträge in Wiener Psychoanalytiker-Kreisen ausführte; unter anderem
entwarf Augenfeld den Schreibtischstuhl Sigmund Freuds. Später war er Assistent
Strnads. 1938 emigrierte Augenfeld in die USA, Karl Hofmann nach Australien. Zu
Augenfeld s. auch: Ruth Hanisch, Felix Augenfeld, Diplomarbeit Universität Wien
1995.
-
2 s. Werkverzeichnis Oskar Strnad, in: Iris Meder, Evi Fuks (Hg.),
Oskar Strnad 1879-1935, Salzburg: Pustet/Jüdisches Museum Wien, 2007.
-
3 Max Fellerer an Milan Dubrovic, 9. 9. 1949 (Nachlass
Dubrovic, Wien Bibliothek).
-
4 s. Patricia Steines, Hunderttausend Steine. Wien: Falter
Verlag, 1993. Die Unterlagen zum Wettbewerb befinden sich in den
Central
Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) in Jerusalem (Archiv der
IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 1176).
5 s. Dresslers Kunsthandbuch, Berlin: Curtius, 9. Jg. 1930.
6 s. z. B. Architektur und Bautechnik 1932, H. 3, S. I;
Österreichische Bauzeitung 1932, S. 245f.; Moderne Bauformen 1932, S. 289ff.;
Zeitschrift des ÖIAV 1932, S. 53f.; Leopold W. Rochowanski, 60 wachsende Häuser,
Wien 1932, S. 48ff.; Das Wüstenrot-Eigenheim 1933, S. 16.
7 s. Helmut Weihsmann, In Wien gebaut. Lexikon der Wiener
Architekten des 20. Jahrhunderts. Wien: promedia, 2005.
8 s. profil 1933, S. 80f.
9 s. Alois Ortner, Geschäftsportale, Wien 1935, S. 58.
10 Der Wiener Tag, 1. 3. 1933, S. 3.
11 s. profil 1933, S. 241. Zur Kahlenberg-Bebauung s. auch:
Iris Meder, Semmering und Akropolis – Die Bebauung des Kahlenbergs, in: Judith
Eiblmayr/Iris Meder (Hg.), Moderat Modern. Erich Boltenstern und die Baukultur
nach 1945, Wien Museum/Verlag Anton Pustet, 2005.
12 Brief Ponzens an Boltenstern vom 13. November 1934, Archiv
Erich Boltenstern, Wien.
13 Briefwechsel Ponzen–Boltenstern sowie diverse
Stellungnahmen der Kahlenberg AG, der ZV und der Ingenieurkammer, Archiv Erich
Boltenstern, Wien. Der für Ponzens Zurückdrängung verantwortliche Vorsitzende
der Kahlenberg AG, Rudolf Neumayer, stieg 1938 nach der Entlassung Norbert
Liebermanns zum Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung auf.
14 profil 1934, S. 114f.
15 Für Recherchen zu diesem Projekt danke ich Maroš Semančík
vom Museum Kežmarok.
16 s. IKG a/VIE/IKG/I-III/LG/Wien 9/Faszikel 7.
17 Lurje war in Wien für die Keramikfirma Brüder Schwadron
tätig. In Berlin realisierte er 1924 die Ausstattung des Messehauses „Haus am
Tiergarten" in der Bellevuestraße sowie 1928 Intarsien in der Bibliothek von
Heinrich Straumers Haus Otto Stolberg in Charlottenburg. Weiter entstanden unter
anderem ein intarsierter Pfeiler im Teeraum von Emil Fahrenkamps Hotel Vier
Jahreszeiten in Hamburg und Wandbilder für die Düsseldorfer „Rheinterrassen"
(beide 1926) sowie 1927 Wandbilder und Plastiken im Hotel Duisburger Hof in
Duisburg (Architekten Pfeifer und Grossmann), außerdem 1930-31 die
Gemeindewohnhausanlage Wien 15, Loeschenkohlgasse 35-37/Pilgerimgasse 4-6.
18 s. MAK-Kunstblättersammlung.
19 s. Weihsmann, In Wien erbaut.
20 zu Ponzen s. auch: Iris Meder, Offene Welten – die Wiener Schule im
Einfamilienhausbau 1910-1938. Dissertation Universität Stuttgart 2001,
elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2005/2094/(Buchpublikation in
Vorbereitung).
|
|
|
|