|
|
|
Die Schwabacher „Judenlettern"
Gerald GNEIST
Bei der typographischen Gestaltung1
von Druck-erzeugnissen kommt der Bruchschrift heute kaum noch eine Bedeutung
zu. Die bis zum Jahre 1941 in vielerlei Variationen für den Buchdruck so
häufig gegossenen Typen blieben im Gedächtnis des Volkes lediglich als
„Nazischrift" in Erinnerung. Dabei sind gerade diese Lettern kein Erbe der
Nationalsozialisten, aber wer weiß das heute noch?
Bereits im 15. Jahrhundert kamen im
Schriftsatz neben der alten Antiqua die Fraktur- oder Bruchschriften auf2,
sodass die Buchdrucker im Verlauf der Entwicklung bei gegossenen
Druckschriften allmählich auf viele verschiedene Schriftgattungen und
Sonderschriften3 zurückgreifen konnten. Die Nachfolger Gutenbergs
definierten die Frakturschriften auch als gotische oder deutsche Schriften,
was aber nicht dazu führte, dass etwa die Antiqua4 gegenüber der
Fraktur bedeutungslos geworden wäre. Gerade aus diesem Grund konnte sich im
deutschen Raum seither jene so charakteristische Zweischriftigkeit
herausbilden, die heute fast völlig verloren gegangen ist. Das Phänomen der
Parallelität im Schriftsatz war seitdem innerhalb der Zunft der Buchdrucker
verwurzelt, in den alten Schriftgießereien schuf man meist gleichzeitig
Fraktur- und Antiquaschriften. Beiden Schriftarten haftete optisch, bedingt
durch den Schriftcharakter gerundeter bzw. gebrochener Typen, eine sehr
große Gegensätzlichkeit an, die noch gesteigert wurde durch den
jahrzehntelang tobenden Streit zwischen Anhängern der lateinischen Antiqua
und jenen der deutschen Fraktur. Dies war ein Kampf, der auch auf
weltanschaulichem Boden ausgetragen wurde. Trotz dieser Querelen setzte im
Schriftsatz eine äußerst schöpferische Entwicklung ein. Aus der Überfülle
vorhandener Frakturschriften und ungeachtet unterschiedlichster Schnitte,
die eine nahezu unbegrenzter Ausdrucks- und Wandlungsfähigkeit der Typen
erlaubten, erlangte dennoch eine einzige Bruchschrift überragende Bedeutung,
nämlich die Schwabacher Schrift. Diese überaus beliebte Fraktur war
zunächst eigentlich die Schrift der Renaissance- und der Reformationszeit
gewesen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde sie weitgehend durch andere
Bruchschriften verdrängt, erlebte aber im Zeitungsdruck des deutschen
Sprachraumes während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Blüte.
Viele Zeitschriften in Deutschland verwendeten im Satz wieder die
Schwabacher Lettern; auch in österreichischen Boulevardblättern
beherrschten diese den Satzspiegel. Erst durch das Geheime Rundschreiben vom
3. Jänner 1941 wurde im gesamten „Deutschen Reich" und somit auch in der
„Ostmark" die Schwabacher für Druckerzeugnisse verboten. Martin
Bormann teilte den Reichsleitern, Gauleitern und Verbändeführern im Auftrag
des Führers mit:
„Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche
Schrift anzusehen oder zu bezeichnen ist falsch. In Wirklichkeit besteht die
sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern. Genau wie
sie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten, setzten sich die in
Deutschland ansässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den Besitz der
Buchdruckereien, und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung
der Schwabacher Judenlettern. Am heutigen Tage hat der Führer in
einer Besprechung mit Herrn Reichsleiter Amann und Buchdruckereibesitzer
Adolf Müller entschieden, dass die Antiquaschrift künftig als Normal-Schrift
zu bezeichnen sei. Nach und nach sollen sämtliche Druckerzeugnisse auf diese
Normal-Schrift umgestellt werden. Sobald dies schulbuchmässig möglich ist,
wird in Dorfschulen und Volksschulen nur mehr die Normal-Schrift gelehrt
werden. Die Verwendung der Schwabacher Judenlettern durch Behörden wird
künftig unterbleiben; Ernennungsurkunden für Beamte, Strassenschilder u.
dgl. werden künftig nur mehr in der Normal-Schrift gefertigt werden. Im
Auftrage des Führers wird Herr Reichsleiter Amann zunächst jene Zeitungen
und Zeitschriften, die bereits eine Auslandsverbreitung haben, oder deren
Auslandsverbreitung erwünscht ist, auf Normal-Schrift umstellen."5
Allein die Tatsache, eine Antiquaschrift als „normal" zu
bezeichnen, implizierte, die Frakturschriften als „abnormal" zu
disqualifizieren. Hier waren handfeste politische Ziele im Spiel, galt es
doch, durch die Vereinheitlichung der Schriften die paneuropäischen
Herrschaftspläne europäischer Faschisten - natürlich unter deutscher Führung
- zu realisieren. Somit lag der Grund für den „typographischen Unfug"
Hitlers in der berechnenden Absicht, dieses letternreine „neue Europa"
künftig leichter anführen zu können. Mittels dieser Maßnahme wurde
Deutschland, das sich damals satztechnisch durch die Dominanz der
Frakturschriften ohnehin schon deutlich von kyrillischen Schriften des
Ostens distanziert hatte, dem „lateinischen", kapitalistischen Westen
zugeschlagen. Steinberg, der Historiker der Druckkunst, bemerkte dazu später
trocken, dies sei „the one good thing Hitler did for German civilisation",
gewesen.
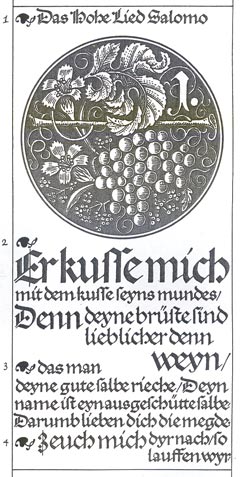
Das Bild zeigt einige Zeilen des 1983 in
der DDR erschienen Buches Das Hohe Lied Salomo. Es handelt sich um eine
Sammlung althebräischer Liebes- und Hochzeitslyrik in der Übersetzung von
Martin Luther. Der Text lautet: „Er kusse mich mit dem kusse seyns mundes/denn
deyne brüste sind lieblicher denn weyn/. Abbildung mit freundlicher
Genehmigung: Gerald Gneist
Die Entscheidung der Nationalsozialisten, bei
Druckerzeugnissen den Antiquaschriften den Vorrang zu geben, um die
weitreichenden Pläne einer NS-Herrschaft umsetzen zu können, führte dazu,
dass heutzutage die gedruckten Frakturschriften nur mit Mühe gelesen werden
können. Jungen Historikern etwa bleibt dadurch das Lesen von
Geschichtsquellen im Originaldruck oder in der Originalschrift vorenthalten.
Rudolf Koch, überzeugter Christ, Lehrer und Ehrendoktor
der Theologie schrieb schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts:
„Die Kunst des Schreibens ist heute zu einem großen Teil
den Kunstfreunden, ja selbst den Künstlern eine fernliegende, [...] unserer
Zeit nicht mehr gemäße Fertigkeit."
Koch war ein Verehrer der großen Leistungen anderer
Völker. Das Alte Testament imponierte ihm; die schönsten Handschriften
fanden sich seiner Meinung nach in den Psalmen- und Prophetentexten. Für
eine jüdische Gemeinde stellte er handgetriebene Kultgeräte und
Schriftteppiche in hebräischer Sprache her. Der spätere Offenbacher
Ehrenbürger Siegfried Guggenheim zählte zu seinen besten Freunden. Im
nordamerikanischem Exil veröffentlichte Guggenheim in Neu York anno 1948
posthum das Buch Rudolf Koch, His Work and the Offenbach Workshop.
Koch, am 9. April 1934 verstorben, hatte weder
Röhm-Putsch noch Nürnberger Rassegesetze miterleben müssen. Sein früher Tod
verhinderte den Konflikt mit den neuen Herren Großdeutschlands, welche die
Schwabacher in den Setzkästen nicht mehr dulden wollten. Die Frakturschrift
aber ist mehr als ein Mittel zum Zweck: Sie schafft ein erweitertes
Lebensgefühl, sie ist ein Mittel der Bildung.
1 Mit der Erfindung des Buchdruckes setzte eine
Entwicklung der Typographie ein, die, ausgehend von der lateinischen
Druckschrift, Anregungen der Kalligraphie aufnahm und die Schwerpunkte der
graphischen Gestaltung einerseits auf Formenstrenge und andererseits auf
Dekorativität legte.
2 Die Fraktur erschien zum ersten Mal 1513 in einem
Gebetbuch Kaiser Maximilians.
3 Unter Schrägschriften (Kursivschriften) sind im
deutschen Schriftsatz nicht nur Bruchschriften (Frakturschriften) zu
verstehen, sondern auch Rundschriften (Antiquaschriften, die alle „s" -
Formen aufweisen), die von deutschen Schriftschöpfern bzw. Gießereien als
Hausschnitt herausgebracht wurden.
4 Die Antiqua, Lateinschrift oder noch besser Altschrift
genannt, ist eine aus der lateinischen Quadrat- und der Humanistenschrift
abgeleitete Druckschrift.
5 Quelle: Bundesarchiv Koblenz. Man beachte übrigens die „s" - Schreibung
der Nationalsozialisten, die unangenehm an die letzte deutsche
Rechtschreibreform erinnert.
Zurück
|
|
|
|